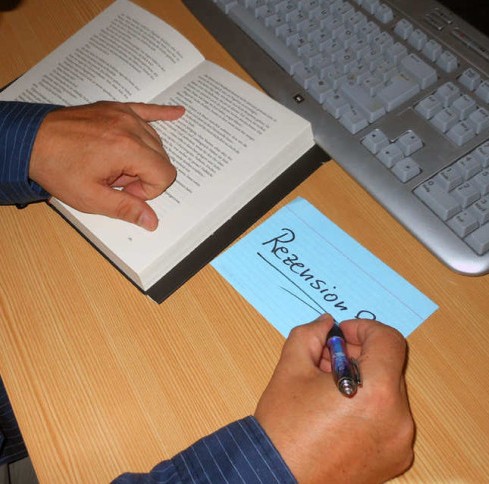Akademische Fachzeitschriften, die sich „klassisch“ durch Abonnentengebühren finanzieren, fordern von den Autoren die Übertragung von Urheberrechten an ihren Artikeln auf den Verlag. Dies ist nötig, um ihr Businessmodell möglich zu machen. Diese Praxis steht zwar im Rahmen der Open Access Bewegung zur Diskussion, kann aber nicht grundsätzlich als rechtlich oder ethisch problematisch bezeichnet werden. Jüngst hingegen, machte der angesehene Verlag „Nature Publishing Group“ von sich Reden, indem er neuerdings von den Autoren auch die Übertragung von, respektive den Verzicht auf Urheberpersönlichkeitsrechte fordert. Diese garantieren dem Autor zwei für den akademischen Publikationsbetrieb wichtige Rechte: Einerseits das Recht auf Anerkennung seiner Urheberschaft (mit anderen Worten: das Recht, seine Artikel mit seinem Namen versehen zu lassen) und andererseits, dass sein Werk nicht ohne Einverständnis verändert werden darf (außer bei stark eingeschränkten und seltenen Ausnahmefällen). Besonders der erste Punkt trifft ins Herz des akademischen Publikationsbetriebs: Die Wirtschaft setzt finanzielle Anreize, in der Forschung hingegen ist der Reputationsgewinn die Triebkraft. Sichert sich ein Verlag die Möglichkeit, Artikel anonym zu veröffentlichen, so steht das gesamte System auf dem Spiel.
Akademische Fachzeitschriften, die sich „klassisch“ durch Abonnentengebühren finanzieren, fordern von den Autoren die Übertragung von Urheberrechten an ihren Artikeln auf den Verlag. Dies ist nötig, um ihr Businessmodell möglich zu machen. Diese Praxis steht zwar im Rahmen der Open Access Bewegung zur Diskussion, kann aber nicht grundsätzlich als rechtlich oder ethisch problematisch bezeichnet werden. Jüngst hingegen, machte der angesehene Verlag „Nature Publishing Group“ von sich Reden, indem er neuerdings von den Autoren auch die Übertragung von, respektive den Verzicht auf Urheberpersönlichkeitsrechte fordert. Diese garantieren dem Autor zwei für den akademischen Publikationsbetrieb wichtige Rechte: Einerseits das Recht auf Anerkennung seiner Urheberschaft (mit anderen Worten: das Recht, seine Artikel mit seinem Namen versehen zu lassen) und andererseits, dass sein Werk nicht ohne Einverständnis verändert werden darf (außer bei stark eingeschränkten und seltenen Ausnahmefällen). Besonders der erste Punkt trifft ins Herz des akademischen Publikationsbetriebs: Die Wirtschaft setzt finanzielle Anreize, in der Forschung hingegen ist der Reputationsgewinn die Triebkraft. Sichert sich ein Verlag die Möglichkeit, Artikel anonym zu veröffentlichen, so steht das gesamte System auf dem Spiel.
In der Praxis nur halb so wild
Das betreffende Verlagshaus beteuert, dass es ihm ausschließlich um den zweiten Punkt geht: Wird der Inhalt eines Artikels gerechtfertigterweise angezweifelt, so will der Verlag sich die Möglichkeit offen halten, Korrekturen zu publizieren oder einen Artikel zurückzuziehen – im Extremfall auch gegen den Willen des Autors. Und selbst dies geschehe erst, beteuert die „Nature Publishing Group“, wenn alle Möglichkeiten der Kooperation mit dem Autor ausgeschöpft seien. Inhaltlich kling dies schlüssig, denn Autoren und Journals sind gegenseitig aufeinander angewiesen. Zwar kann ein Verlag, der sehr anerkannte Fachzeitschriften beheimatet, durchaus einen gewissen Druck auf Autoren ausüben. Würden die neuen Vertragsbestimmungen jedoch in die Tat umgesetzt und Texte verändert oder weiterentwickelt und ohne Verbindung zum Namen des Autors veröffentlicht werden, worin bestünde denn deren Motivation, kostenlos Inhalte zur Verfügung zu stellen?
Und in Zukunft?
Die Open Access Idee hat in der akademischen Verlagslandschaft bereits breite Umwälzungen angestoßen. Noch ist nicht klar, ob und welche neuen potentiellen Businessmodelle einzelne Verlage testen werden. In diesem Umfeld ist eine gesunde Skepsis im Bezug auf geistige Eigentumsrechte sicherlich angebracht. Juristisch steht der Verzicht auf Urheberpersönlichkeitsrechte sowieso auf tönernen Füssen, da der komplette und direkte Verzicht darauf in den USA zwar möglich, beispielsweise in Deutschland hingegen unzulässig ist. Die allgemeine Umsetzbarkeit der neuen Vertragsbestimmungen ist also zumindest zweifelhaft. Bisher sind Vertragstexte dieser Art erst aus einem (wenn auch einem bedeutenden) Verlagshaus bekannt geworden, mehr oder weniger zufällig aufgedeckt im Rahmen eines Zwistes um Open Access Rechte mit der Duke Universität. Letztlich wäre im aktuellen angespannten Umfeld eine konstruktive Kommunikation zwischen Verlagen und Instituten oder Universitäten wünschenswert. Bis sich die Wellen geglättet haben, bleibt einzelnen Autoren kaum mehr, als sich mit den zuständigen Stellen ihrer Institution kurzzuschließen und von Fall zu Fall über den geeigneten Verlag für ihre Artikel zu entscheiden.
Die Harmonie von Open Access Philosophie und akademischer Forschung ist gewissermaßen noch in der Testphase. Es bleibt zu hoffen, dass das Pendel nun nicht zurückschwingt und im finanziellen Interesse der Verlage die Barrieren erhöht werden, die dem Zugang zum Wissen entgegenstehen.