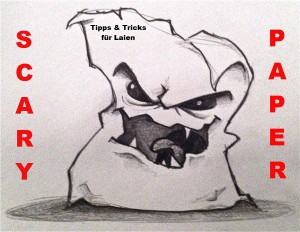Die Leserschaft eines wissenschaftlichen Artikels ist keine homogene Gruppe. Einige Personen haben Gründe, aus welchem sie einen Artikel im Detail lesen wollen oder müssen. Für andere reicht es, sich mit wenigen Elementen des Artikels zu beschäftigen, um sich einen Überblick über die Resultate zu verschaffen. Wiederum andere entscheiden erst aufgrund dieser Elemente, den Artikel zu lesen. Spezifisch haben also der Titel, das Abstract, die Schlussfolgerung und die Illustrationen zwei Aufgaben: Sie sollen Interesse wecken, andererseits aber auch wichtige Informationen in knapper Form verständlich kommunizieren.
Die Leserschaft eines wissenschaftlichen Artikels ist keine homogene Gruppe. Einige Personen haben Gründe, aus welchem sie einen Artikel im Detail lesen wollen oder müssen. Für andere reicht es, sich mit wenigen Elementen des Artikels zu beschäftigen, um sich einen Überblick über die Resultate zu verschaffen. Wiederum andere entscheiden erst aufgrund dieser Elemente, den Artikel zu lesen. Spezifisch haben also der Titel, das Abstract, die Schlussfolgerung und die Illustrationen zwei Aufgaben: Sie sollen Interesse wecken, andererseits aber auch wichtige Informationen in knapper Form verständlich kommunizieren.
Grafiken, Tabellen, Diagramme, Bilder und Illustrationen müssen trotz hoher Informationsdichte verständlich sein und ansprechend aussehen. Präsentation ist zwar nicht alles, kann aber den Unterschied ausmachen zwischen einem Paper, das kaum beachtet wird und einem das gelesen und zitiert wird. Für die Erstellung und den bevorzugten Typ von Illustrationen gibt es je nach Fachrichtung etablierte Programme und Techniken, die Unterschiedliches möglich machen. Zudem muss sich der Autor immer an die Formatvorgaben des Journals halten, in dem er publizieren möchte. Daneben gibt es jedoch einige allgemeingültige Grundregeln für den optimalen Einsatz von Illustrationen. Die häufigsten Fehler lassen sich mit wenig Aufwand vermeiden. Mit der folgenden Checkliste stellen Sie sicher, dass Ihre Abbildungen nicht abschreckend auf Ihre Leser wirken:
- Daten sind nie Selbstzweck. Überlegen Sie sich genau, was Sie aussagen wollen und wählen Sie jenen Illustrationstyp, der sich dafür am besten eignet. Nur weil beispielsweise das verwendete Statistikprogramm komplexe Darstellungen möglich macht, heißt das nicht, dass diese immer einer Tabelle oder einer schlichteren Grafik überlegen sind. Halten Sie sich an die Konventionen Ihres Faches!
- Illustrationen müssen groß genug und gut lesbar sein. Wo mehrere umfangreiche Darstellungen nötig sind, die den Lesefluss stören, sollte überlegt werden, ob diese in einen Anhang verschoben werden können. Insbesondere gehören Rohdaten in den Anhang.
- Illustrationen müssen beschriftet und nummeriert werden. Tabellen und andere Illustrationen in den Anhängen werden separat nummeriert. Verweise im Text sollten sich auf die Nummerierung und nicht auf die Seitenzahl beziehen.
- Bei Grafiken sollte der Achsenausschnitt und die Einheit so gewählt werden, dass die interessanten Bereiche bestmöglich erkennbar sind.
- Für die Beschriftung von Achsen und Datenpunkten, den Einsatz von Symbolen und Farben und das Einfügen von Legenden und Titeln gilt: So viel wie nötig, so wenig wie möglich! Solche Elemente dürfen nicht von den Daten ablenken, müssen aber alle notwendigen Informationen wiedergeben (inklusive jener, die bereits im Titel der Illustration enthalten sind). Graphische Spielereien wie Schattierungen oder unnötige Hilfslinien sollten vermieden werden.
- Der Leser sollte Illustrationen nie selbst interpretieren müssen, selbst Bilder nicht: Der Text des Artikels muss erklären, was aus der Illustration hervorgeht. Was für den Autoren, der Tage oder Wochen über einem Datensatz brütet, offensichtlich ist, erschließt sich dem eiligen Leser nicht immer sofort.
Ein guter Test für die Aussagekraft und die Qualität einer Illustration ist die Reaktion eines fachfremden Publikums (wenn auch je nach Spezialisierung einige Statistikkenntnisse vorausgesetzt werden müssen). Legen Sie Ihre Graphiken oder Bilder (mit Über- und Unterschrift und gegebenenfalls einem kurzen Begleittext) einem Bekannten vor, der nicht in Ihrem Feld tätig ist! Falls dieser mehr Begeisterung zeigt, als wenn Sie beim Café von Ihrem jüngsten Projekt erzählen, dann haben Sie ihr Ziel erreicht!