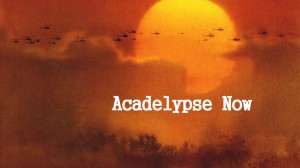 Wer sich mit den Strukturen in der Welt der Forschung und des akademischen Publizierens beschäftigt, der begegnet einem Wort unangenehm oft: „kaputt“. Tatsächlich scheint einiges aus den Fugen geraten zu sein: Forschende müssen ihre Ellenbogen einsetzen, um an Budgets und Positionen zu kommen. Profitorientierte Verlage streichen Gewinne ein, die letztlich von der öffentlichen Hand berappt werden. Ein Peer Reivew kann Monate dauern und die Flut an schlechten Papers, Konferenzen und Journals macht es schwierig, den Überblick zu behalten. Die schwierige Situation resultiert, weil gleich mehrere Eckpfeiler der Forschung außer Balance gekommen sind, die Störfelder verstärken sich gegenseitig. Verschiedene Neuerungen tun also Not. Die Problemfelder voneinander zu trennen und einzeln anzugehen ist schwierig. Die gute Nachricht? Tatsächlich sind Änderungen im Gang und neue Modelle in der Testphase!
Wer sich mit den Strukturen in der Welt der Forschung und des akademischen Publizierens beschäftigt, der begegnet einem Wort unangenehm oft: „kaputt“. Tatsächlich scheint einiges aus den Fugen geraten zu sein: Forschende müssen ihre Ellenbogen einsetzen, um an Budgets und Positionen zu kommen. Profitorientierte Verlage streichen Gewinne ein, die letztlich von der öffentlichen Hand berappt werden. Ein Peer Reivew kann Monate dauern und die Flut an schlechten Papers, Konferenzen und Journals macht es schwierig, den Überblick zu behalten. Die schwierige Situation resultiert, weil gleich mehrere Eckpfeiler der Forschung außer Balance gekommen sind, die Störfelder verstärken sich gegenseitig. Verschiedene Neuerungen tun also Not. Die Problemfelder voneinander zu trennen und einzeln anzugehen ist schwierig. Die gute Nachricht? Tatsächlich sind Änderungen im Gang und neue Modelle in der Testphase!
Der Impact Factor
Kritik: Diese Kennzahl ist ein Dorn im Auge vieler Akademiker, denn sie ist etwa gleichermaßen verbreitet wie verhasst. Ihre Aussagekraft für einzelne Artikel ist beschränkt.
Vorteil: Die Leistungen von Akademikern lassen sich quantifizieren, ohne dass ihre Arbeit wirklich gelesen werden muss.
Alternative: Raffiniertere Kennzahlen wie der Eigenfactor beheben einige methodische Probleme, gehen aber nicht die zugrundeliegende Problematik an.
Open Access Ansatz: Downloadzahlen individueller Papers könnten den Impact Factor ergänzen.
Konkurrenz um Slots in prestigeträchtigen Journals
Kritik: Themen mit breitem Publikum finden Anklang; Artikel, die an den Grundfesten einer Disziplin rütteln werden nicht immer gern gesehen.
Vorteil: Die Leserschaft eines hochwertigen Titels spart Zeit und kann sich einer gewissen Mindestqualität sicher sein.
Alternative: Vermehrt machen sich kleinere Journals mit sehr spezifischem Fokus und einer engeren Leserschaft einen Namen.
Open Access Ansatz: Wird jedes Paper veröffentlicht, so kann jede Idee ein Publikum finden. Vorteilhaft wäre auch, dass Artikel mit „verworfener Hypothese“ vermehrt den Schritt in die Öffentlichkeit finden könnten.
Unfaire Profite für kommerzielle Verlagshäuser
Kritik: Akademische Verlage verkaufen Leistungen, die sie nicht finanziert haben und privatisieren die resultierenden Gewinne.
Vorteil: Das Schema, wonach vielzitierte Journals aus einem großen Pool von angebotenen Artikeln die Rosinen picken können und dafür vom Leser hohe Preise verlangen, erspart der Leserschaft die Zeit, die nötig wäre, um sich aus dem gesamten Artikeluniversum selbst eine Leseliste zusammenzustellen.
Alternative: Nicht-profitorientierte Verlage, zum Beispiel von Fachgesellschaften getragene, konkurrieren bereits heute mit den Größen der Industrie.
Open Access Ansatz: Papers werden für den Leser kostenlos zur Verfügung gestellt.
Schlechtes oder langsames Peer Review
Kritik: Unbezahlte Peer Reivew Aufgaben überfordern die Reviewer, der Prozess wird von einigen Journals nicht seriös betrieben; der Ablauf ist schwerfällig und zeitaufwändig.
Vorteil: Die Qualität, Authentizität und Verlässlichkeit eines Papers sollte nach dem Peer Review garantiert sein.
Alternative: Ein Gedankenexperiment (das aber nicht nur auf Gegenliebe stößt) schlägt vor, Reviewer für ihre Dienste zu bezahlen, damit sie sich genügend Zeit dafür nehmen können.
Open Access Ansatz: Post Publication Review ist ein Ansatz, bei dem alle Leser zu Reviewern werden, indem sie Kommentare hinterlassen können, die eine Überarbeitung des Artikels nach sich ziehen können.
Hohe Publikationskosten durch physische Journals
Kritik: Der Druckvorgang ist kosten- und zeitaufwändig.
Vorteil: Gedruckte Journals gehen nach wie vor mit einem gewissen Prestige einher. Zudem entspricht das physische Produkt den Vorlieben einiger Leser.
Alternative: Auch „klassische“ Verlage können zur Onlinepublikation wechseln, ohne ihr Geschäftsmodell anderweitig zu verändern.
Open Access Ansatz: Open Access Titel sind weitgehend Onlinepublikationen ohne Druckerpressen.
Die großen Probleme des Publikations- und Forschungsbetriebes werden nicht isoliert gelöst werden können. Für fast alle Problembereiche stehen momentan verschiedene neue Ansätze zur Debatte. Ob sich die Open Access Idee in allen Bereichen mit wehenden Fahnen durchsetzen wird, darf bezweifelt werden. Offensichtlich scheint aber, dass die klassischen akademischen Verlage sich auf grobe Umwälzungen gefasst machen müssen. Um diese zu überstehen, werden sie eigene Alternativen anbieten müssen. Entwicklungen in den verschiedenen Themenkreisen bedeuten, dass sich die traditionsreiche Branche momentan stark bewegt. Es wir spannend sein zu sehen, welche Richtung die Publikationslandschaft letztlich einschlägt.





