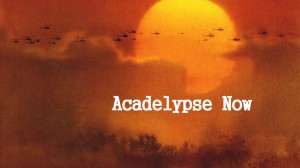Science hat kürzlich eine weitere Reviewrunde zum Prozess hinzugefügt, bei welchem entschieden wird, welche 7% der wöchentlich 250 eingereichten Papers publiziert werden. Das Journal hat dazu einen statistischen Beirat als neues Gremium ins Leben gerufen. Dieser wird mit weiteren externen Statistikexperten zusammenarbeiten. Neu sieht der Prozess so aus, dass Redakteure wie bis anhin die vielversprechendsten Manuskripte ins übliche Review schicken. Jene Artikel, die diese beiden Hürden überstehen, werden dann an den statistischen Beirat weitergereicht, welcher entscheidet, ob eine genaue Untersuchung der Daten und der angewendeten statistischen Methoden nötig ist. Erscheint ihnen dies sinnvoll, wird das Paper wiederum zur weiteren Prüfung an einen oder mehrere Statistikexperten des Fachgebiets weitergeleitet. Die Analyse der statistischen Methoden kann wie in der ersten, eher auf den Inhalt fokussierten Reviewrunde zur Ablehnung des Artikels führen, oder dazu, dass vom Autoren Änderungen verlangt werden.
Science hat kürzlich eine weitere Reviewrunde zum Prozess hinzugefügt, bei welchem entschieden wird, welche 7% der wöchentlich 250 eingereichten Papers publiziert werden. Das Journal hat dazu einen statistischen Beirat als neues Gremium ins Leben gerufen. Dieser wird mit weiteren externen Statistikexperten zusammenarbeiten. Neu sieht der Prozess so aus, dass Redakteure wie bis anhin die vielversprechendsten Manuskripte ins übliche Review schicken. Jene Artikel, die diese beiden Hürden überstehen, werden dann an den statistischen Beirat weitergereicht, welcher entscheidet, ob eine genaue Untersuchung der Daten und der angewendeten statistischen Methoden nötig ist. Erscheint ihnen dies sinnvoll, wird das Paper wiederum zur weiteren Prüfung an einen oder mehrere Statistikexperten des Fachgebiets weitergeleitet. Die Analyse der statistischen Methoden kann wie in der ersten, eher auf den Inhalt fokussierten Reviewrunde zur Ablehnung des Artikels führen, oder dazu, dass vom Autoren Änderungen verlangt werden.
No se puede dejar de lado el bingo, ya que hay muchos nombres de operadores online como Golmania, así como variantes de juegos de keno y arcade. Todos los operadores en línea que encontrarás en https://casinos-enlinea.com/ ChoiceCasino son legales en México y tienen una licencia nacional o internacional.
Mangelnde Fähigkeiten im Bereich Statistik
Science riskiert mit diesem Vorgehen den ohnehin schon schwerfälligen Publikationsprozess zusätzlich zu verlängern, reagiert aber auf ein schwerwiegenderes Problem: Die zunehmende Anzahl an Artikeln, die nach ihrer Veröffentlichung zurückgezogen werden müssen. Teilweise sind Fälschungen und Betrug an dieser Entwicklung schuld, oft aber auch simple Fehler in der Datenverarbeitung oder in der Anwendung der Statistik. Dies mag daher rühren, dass der Druck auf Wissenschaftler zugenommen hat, mehr Artikel in weniger Zeit zu veröffentlichen. Ein weiterer Faktor ist jedoch, dass sich statistische Methoden und Programme stetig entwickeln und komplexer werden. Nicht jeder Forschende kann genügend Zeit darauf verwenden, sich fundiert einzuarbeiten und auf dem Laufenden zu halten.
Die strikte Kultur der Medizin übernehmen
Die Topmagazine im Bereich der Medizin und der Biochemie legen traditionell großen Wert auf eine genaue Datenprüfung. Science ist nicht das erste Journal, das versucht, diese Kultur auf andere Fachbereiche zu erweitern. Verschiedentlich greifen Journals zu genaueren Prüfungen, sei es durch Statistikexperten oder durch den Einsatz von formalisierten Checklisten, anhand derer Redakteure oder Reviewer sicherstellen sollen, dass nötige statistische Informationen vollständig publiziert und korrekt sind.
Die Killerkriterien
Um sicherzugehen, dass Ihr nächstes Manuskript nicht in einer solchen Prüfung hängen bleibt, sollten Sie darauf achten, dass der Methodenteil Ihres Papers genügend Informationen enthält. Alle statistischen Tests und Methoden (mit der Ausnahme der absolut geläufigen, etwa des t-Tests) sollten nicht nur benannt, sondern auch beschrieben werden. Nutzen Sie diese Aufgabe, um kritisch zu überprüfen, ob Sie Ihren Ansatz wirklich bewusst gewählt haben, im Detail verstehen, und entsprechend rechtfertigen können! Wichtig ist selbstverständlich auch, dass simple Angaben wie etwa die Stichprobengröße nicht schlicht vergessen werden.
Informieren Sie sich, ob das Journal, in welchem Sie publizieren möchten, eine veröffentlichte Checkliste oder konkrete Richtlinien verwendet (oft sind diese Bestandteil einer allgemeinen Checkliste, die der Autor vor der Einreichung des Artikels durchgehen soll)! Ist dies nicht der Fall, so kann man für die Überprüfung des eigenen Textes die Kriterien eines anderen Journals der Fachrichtung verwenden. Nature und das British Medical Journal (BMJ) etwa stellen entsprechende Informationen zur Verfügung.
Die zusätzlichen Prüfungen und das lange Hin und Her wegen einfachen Nachlässigkeiten mag Autoren bisweilen als Schikane vorkommen. Wenn solche Checks aber helfen zu verhindern, dass Papers abgelehnt werden, oder schlimmer noch: zurückgezogen werden müssen, so sind sie eine begrüßenswerte Entwicklung. Wer nach mehreren erfolgreichen Publikationen denkt, Checklisten nicht nötig zu haben, der ändert vielleicht seine Meinung, wenn er sich vor Augen führt, dass auch Chirurgen und Astronauten trotz erstklassiger Ausbildung mit dieser Methode gegen vermeidbare Fehler vorgehen!